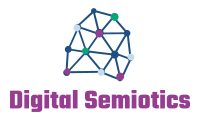Gedanken am Ende des 17ten internationalen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Semiotik 2024

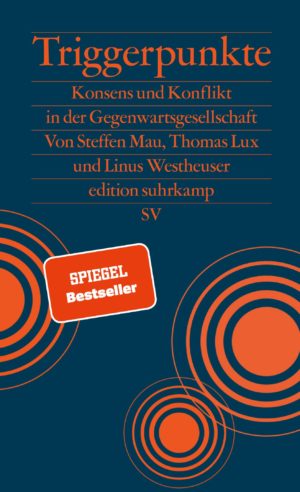
Wenn wir jetzt mal die o.g. populärwissenschaftlichen Bestseller beiseite lassen und uns dem Kernthema des 2024er DGS-Kongresses, der Digitalität, zuwenden, das größtenteils dann noch auf das Feld der KI konzentriert wurde, was passiert dann oder was würde dann passieren? Das aktuell zentrale Konzept hinter dem Boom der sogenannten KI sind die LLM, die Large-Language-Modells. Auch zentral: die Aufsplittung von Sätzen und Wörtern in sogenannte Tokens – die sogar die Grundlage des Abrechnungsmodells, costs per token, liefern. Als letztes sei herausgegriffen, dass hinter der erstaunlichen und leistungsfähigen Performanz der aktuellen KI-Angebote der Ansatz steht, dass sich Bedeutung über den statistischen Durchschnitt großer Mengen von Äußerungen ermitteln lässt.
Ich hoffe hier wird klar, was ich meine, wenn ich sage, dass es sehr fruchtbar sein könnte, wenn sich Proto-Semiotiker:innen und Profi-Semiotiker:innen zusammentun. Auf dem 2024er DGS-Kongress zu Zeichen, Digitalität, Kulturen konnte man das in Ansätzen gut erkennen. Fachwissenschaftler:innen eröffneten einen tiefen Einblick in ihr Tun und wo da Zeichennutzungen eine Rolle spielen. Gerade die jungen Semiotiker:innen machten sich daran relevante Gesellschaftsphänomene semiotisch zu untersuchen, mit sehr erhellenden Ergebnissen. Die eher etablierten Semiotiker:innen gingen für meinen Geschmack immer noch zu sehr ihrer Lieblingsbeschäftigung nach, semiotische Klassiker miteinander zu vergleichen, ohne daraus dann Konsequenzen für das semiotische Arbeiten oder gar für drängende Gesellschafts- und Weltfragen zu ziehen. Und hier liegt für mich auch das noch ungenutzte Potential der institutionellen Semiotik. Ihre Interdisziplinarität muss im Disziplinaritäts-Teil besser ausgearbeitet werden. Es muss dauerhafter und zielorientierter und in Teams gearbeitet werden. Und sie muss sich an drängendere, größere Fragestellungen heranwagen.
Semiotik kann Antworten auf die großen Fragen der Digitalisierung liefern
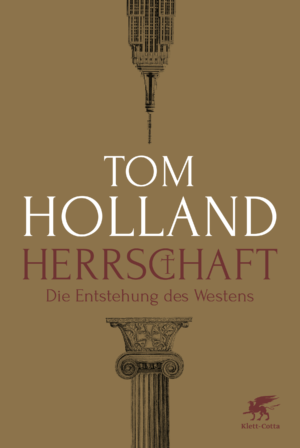
Herrschaft. Klett-Cotta Verlag
Digitalität erschöpft sich für Semiotiker:innen zu oft in Social Media Oberflächen-Phänomenen. Wie interessant kann die zwanzigste Analyse eines Memes schon sein? Antwort: Ja. Wäre es nicht spannender zu verfolgen, was den medialen Diskurs, die medialen Zeichenprozesse und Zeichensysteme, zur sogenannten KI, von anderen früheren Digitalhypes von der Social Economy über das Metaverse bis zu Blockchain unterscheidet und was nicht? Sollten Semiotiker:innen nicht wissenschaftlich begleiten, was bei der Anlage und Verarbeitung der Data Lakes passiert, die die Grundlage der LLMs bilden? Bzw. wenn diese als Betriebsgeheimnisse des Silicon Valley unerreichbar sind, sollten nicht eigene semiotische Forschungs-Daten-Seen angelegt werden? Aufbauend auf den Erfahrungen, die man mit verschiedenen Zeichen-Corpora schon hat. Sollten wir als Semiotik nicht der Interpretativität nachspüren, die in so vielen vermeintlich objektiven Berechnungen der KI-Anwendungen liegt und sich in dem für viele so gleichermaßen ehrfurchtgebietenden wie abschreckenden Begriff Stochastik versteckt? Womit wir bei einem meiner Lieblingsthemen: der Semiotik des Consultings bzw. der Consulting-Technologie wären.
Semiotik als die Wissenschaft der VUCA-World
Semiotik ist eine kleine Wissenschaft aber sie ist gerade in unserer VUCA-World, in einer volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt, hoch anschlussfähig und kann wie ein Katalysator wirken.
Sie hat mit den wechselnden Blicken auf Zeichenphänomene als Kern-Methode Interdisziplinarität in ihrer DNA. Sie hat Zeichenphänomene als Kern-Gegenstand, was sie zur VUCA-Wissenschaft prädestiniert. Und sie kann im Austausch mit anderen Disziplinen, die ihrerseits auf Zeichenphänomene stoßen, bewährte und elaborierte Konzepte und Methoden zur Verfügung stellen und diese dann – wahrscheinlich besser als in weiteren intrasemiotischen Textexegesen – weiterentwickeln.